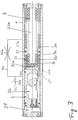EP0733763A1 - Türschliesser - Google Patents
Türschliesser Download PDFInfo
- Publication number
- EP0733763A1 EP0733763A1 EP19960104540 EP96104540A EP0733763A1 EP 0733763 A1 EP0733763 A1 EP 0733763A1 EP 19960104540 EP19960104540 EP 19960104540 EP 96104540 A EP96104540 A EP 96104540A EP 0733763 A1 EP0733763 A1 EP 0733763A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- piston
- energy store
- door
- door closer
- partial energy
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 claims description 50
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 20
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims 2
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 4
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 3
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 description 3
- 239000010720 hydraulic oil Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000036962 time dependent Effects 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05F—DEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
- E05F3/00—Closers or openers with braking devices, e.g. checks; Construction of pneumatic or liquid braking devices
- E05F3/22—Additional arrangements for closers, e.g. for holding the wing in opened or other position
- E05F3/223—Hydraulic power-locks, e.g. with electrically operated hydraulic valves
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05F—DEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
- E05F3/00—Closers or openers with braking devices, e.g. checks; Construction of pneumatic or liquid braking devices
- E05F3/04—Closers or openers with braking devices, e.g. checks; Construction of pneumatic or liquid braking devices with liquid piston brakes
- E05F3/10—Closers or openers with braking devices, e.g. checks; Construction of pneumatic or liquid braking devices with liquid piston brakes with a spring, other than a torsion spring, and a piston, the axes of which are the same or lie in the same direction
- E05F3/102—Closers or openers with braking devices, e.g. checks; Construction of pneumatic or liquid braking devices with liquid piston brakes with a spring, other than a torsion spring, and a piston, the axes of which are the same or lie in the same direction with rack-and-pinion transmission between driving shaft and piston within the closer housing
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05Y—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
- E05Y2800/00—Details, accessories and auxiliary operations not otherwise provided for
- E05Y2800/20—Combinations of elements
- E05Y2800/22—Combinations of elements of not identical elements of the same category, e.g. combinations of not identical springs
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E05—LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
- E05Y—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
- E05Y2900/00—Application of doors, windows, wings or fittings thereof
- E05Y2900/10—Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
- E05Y2900/13—Type of wing
- E05Y2900/132—Doors
Definitions
- the invention relates to a door closer with the features of the preamble of patent claim 1.
- a door closer of the type mentioned at the outset which has an energy store composed of two closer springs, of which the first partial energy store is used for closing during normal operation and the second energy store is only switched on when required, is known from DE-OS 42 37 179. It is a hydraulic door closer with two closer springs, whereby only the weaker closer spring is effective in normal operation and the stronger closer spring is detected by an electrical locking device and is only activated in an emergency via a fire alarm, fire alarm or the like. However, this means that if wind pressure or another obstacle occurs in the door's closing path, complete closing cannot be guaranteed as long as the electrical locking device is switched on.
- So-called servo door closers are known from DE-OS 32 34 319 and DE-OS 34 23 242. They are hydraulic door closers with a closer spring and an electric motor to pretension the closer spring when it is opened.
- the electromotive pretensioning of the closer spring eliminates or at least reduces the opening resistance of the door during manual access.
- the closing process then takes place automatically as in a conventional hydraulic door closer under the action of the closer spring. With each opening process, the closer spring must be preloaded again by an electric motor to maintain the servo effect.
- the invention has for its object to develop a door closer of the type mentioned, which has low opening resistance in normal operation and ensures a complete closing of the door.
- the discharge of the second partial energy store can also be controlled via a sensor device which monitors the closing process, for. B. via a device that determines whether the closing movement is interrupted before reaching the closed position.
- the sensor device detects z. B. current operating data of the door closer or the door, z. B. the operating pressure in a piston-cylinder system in the door closer or the movement speed or the direction of movement of the door or door positions or changes to this data.
- the second partial energy store represents a reserve energy store.
- the timing element or the sensor device ensures that the second partial energy store is automatically effective for securely closing the door when the door does not reach the closed position under the action of the first partial energy store.
- the second partial energy store can interact with a controllable blocking device.
- the blocking device or an actuator of the blocking direction is controlled via the timer or the sensor device.
- the blocking device can block the second partial energy store hydraulically, pneumatically, mechanically or electrically.
- the timer is preferably adjustable or programmable.
- the timing element can be arranged in an overflow device in a piston-cylinder device and can be determined by the flow resistance of the overflow device.
- the overflow device can control the discharge of the second partial energy store.
- the partial energy stores can be formed by pistons connected in series in a cylinder.
- a flow valve preferably an adjustable flow valve, can serve as the timing element of the overflow device.
- an overflow channel or an overflow groove can also be arranged in the cylinder or in the piston.
- different resistance can be switched in the overflow device or different overflow devices with different resistance can be activated one after the other, e.g. B. by successively an overflow groove as short-circuit groove, then an overflow channel with adjustable flow valve and finally an overflow groove as short-circuit groove again; instead of the short-circuit grooves, short-circuit channels can also be provided.
- the discharge of the second partial energy store it is thus possible for the discharge of the second partial energy store to have successive discharge phases of different discharge speeds. It can be realized that the time-delayed discharge of the second partial energy storage z. B. is initially very slow and if after a certain time the door has not yet reached its end position, then the discharge speed is increased and thus the second partial energy store contributes more to the closing in this phase.
- phase in which the second partial energy store serves to provide a strong force for the initial rapid acceleration of the door when closing, a second phase in which it is only discharged relatively slowly and contributes little to the closing and in the event that the door has not yet reached the closed position after a certain time, a third phase takes place, in which the second partial energy store is quickly discharged and the door closes.
- the first partial energy store expediently stores less energy than the second energy store, which is delayed by the time-dependent control, as required, for closing.
- Structurally particularly simple solutions are obtained if closer springs, preferably helical compression springs, are provided as the partial energy store.
- the springs can be arranged in the cylinder of a pneumatic or hydraulic piston-cylinder device and cooperate with the pistons tightly guided in the cylinder.
- the door closing mechanism shown in FIGS. 1 to 3 has a housing 1 in which a hydraulically damped piston 2, an auxiliary piston 22 and a spring arrangement 3 are located in a cylindrical bore.
- the piston 2 is connected to a closer shaft 4 which is rotatably mounted in the housing 1, in the illustrated case via a pinion.
- the pinion consists of a pinion 4a which is connected in a rotationally fixed manner to the closer shaft 4 and a rack 2a fixed to the piston.
- the pinion 4a or the closer shaft 4 rotates counterclockwise in the illustration in the figures.
- the piston 2 is moved to the right.
- the movement takes place in the opposite direction, i.e. the pinion 4a or the closer shaft 4 rotates clockwise and the piston 2 is moved to the left.
- the closing spring device 3 consists of a closing spring 3c and two reserve closing springs 3a, 3b.
- the springs 3a, 3b, 3c are compression springs. These are concentrically arranged helical compression springs.
- the closing spring 3c is supported with its left end directly on the right end face of the piston 2 and with its right end on an auxiliary piston 22.
- the auxiliary piston 22 is received in the cylinder space to the right of the piston 1 and is also guided as a hydraulic piston in the cylinder space.
- the reserve closing springs 3a, 3b are each supported with their left end on the auxiliary piston 22 and with their right end on the right front end of the housing 1 on a housing cover 1r screwed in there.
- the auxiliary piston 22 is cup-shaped and consists of a tubular piston skirt 22a and a piston crown 22b.
- the piston skirt and piston crown can consist of one part (FIGS. 1 to 4) or, e.g. shown in Figures 5 and 6, of 2 parts, the pressure-tight, for. B. are connected by an adhesive or welded connection.
- the diameter of the piston skirt 22a at the piston bottom end of the piston 22 can be made smaller than in the area in which the piston skirt takes over the axial guidance in the piston.
- the inner reserve closing spring 3a is received concentrically in the interior of the piston.
- the left end of the spring 3a is supported against the piston crown 22b. It protrudes from the piston to the right and is supported with its right end on the housing cover 1r.
- the second reserve closing spring 3b is arranged concentrically with the spring 3a. It is supported with its left end against the end face of the piston skirt 22a, with its right end it is supported against the housing cover 1r.
- the auxiliary piston 22 is guided in the cylinder via the piston skirt 22a, the left end of which forms the collar 22c.
- the closing spring 3c is arranged concentrically with the piston outer jacket 22d.
- the spring 3c is supported with its right end against the collar 22c, with its left end against the right end face of the piston 2.
- the sealing element 23 which seals the hydraulic chamber 32a from the hydraulic chamber 32b.
- FIGS. 4 to 6 A further variant for the arrangement of the spring elements 3 and the auxiliary piston 22 is shown in FIGS. 4 to 6:
- the auxiliary piston 22 is rotated by 180 ° with respect to FIGS. 1 to 3, so that the piston head 22b points to the right.
- the concentric reserve springs 3a and 3b are supported with their left ends against the piston crown, with their right ends against the housing cover 1r.
- the closing spring 3c is mounted concentrically to the inside of the auxiliary piston 22. Its right end is supported from the inside against the piston crown 22b, its left end against the right end face of the piston 2.
- This arrangement offers the advantage over the arrangement in FIGS. 1 to 3 that the sealing element 23 arranged in the piston skirt 22a only moves over a cylinder surface is that can not come into contact with the closing spring 3c.
- the closing spring 3c could damage the cylinder wall surface in FIGS. 1 to 3 and thus impair the functionality of the sealing element 23.
- the cylinder interior and the interior of the pistons 2 and 22 are filled with hydraulic oil ( Figures 1 to 6).
- the piston 2 has a sealing element 2d (preferably made of elastomer material) and divides the cylinder space into a hydraulic space 31 on the left of the sealing element 2d and a hydraulic space 32 on the right of the sealing element.
- the hydraulic space 32 is in turn divided by the sealing element 23 (preferably made of elastomer material) into a space 32a, which receives the closing spring 3c, and a space 32b, which accommodates the reserve springs 3a and 3b.
- the hydraulic chamber 31 is connected to the hydraulic chamber 32 via hydraulic channels 36 (FIG. 8) which contain flow valves for regulating the closing and opening speed, as is known in conventional door closers.
- a spring-loaded check valve 2b is arranged in the left end face of the piston 2, which opens during the opening movement when the piston 2 is moved to the right in the figures.
- a pressure relief valve 2c is arranged in the piston 2.
- the sealing element 23 can either be mounted in the piston skirt 22a, as shown in FIGS. 1 to 4, or, as shown in FIG. 5, at a suitable location in the cylinder bore.
- an overflow channel 33 is formed which connects the hydraulic spaces 32a and 32b.
- the overflow channel contains a throttle, preferably an adjustable regulating valve 33a, with which the flow rate of the hydraulic fluid through the channel and thus the speed of movement of the auxiliary piston can be adjusted.
- a shut-off valve 33b in the overflow channel is closed when the door has reached its end position during the closing process.
- a spring-loaded check valve 24 is provided in the piston crown 22b of the auxiliary piston, which opens to overflow the hydraulic fluid from space 32b into space 32a when the auxiliary piston 22 is moved to the right.
- the door closer shown works as follows. The door is opened by hand. The closer shaft rotates with the pinion 4a counterclockwise and the piston 2 is forcibly moved to the right against the action of the closing spring device 3. From the initial position in FIG. 1, the auxiliary piston 22 resting on the piston 1 is taken to the right and the reserve closing springs 3a, 3b are compressed. The closing spring 3c installed in the pretensioned position remains in its pretensioned position.
- the check valve 24 opens, so that the hydraulic oil displaced by the piston movement can flow from the space 32b into the space 32a.
- the piston 2 and the auxiliary piston 22 each reach the right end position in which the reserve closing springs 3a, 3b are maximally compressed.
- the closing process then takes place automatically under the action of the closing spring device 3.
- the door should be accelerated quickly and with greater force.
- This high-speed phase I lasts e.g. 2 seconds.
- the hydraulic space 32b is connected to the hydraulic space 32a through the groove 37a (FIG. 7), which causes a hydraulic short circuit.
- This allows the hydraulic fluid to flow from the space 32b into the space 32a and the reserve closing springs 3a, 3b move the auxiliary piston to the left with great force.
- the movement of the auxiliary piston is transmitted to the main piston via the closing spring 3c; at the same time, the closing spring also pushes the main piston to the left.
- the closer shaft 4 is rotated by the movement of the piston 2.
- the auxiliary piston 22 moves very slowly in a slow speed phase II in accordance with the setting of the throttle valve 33 by the force of the reserve closing springs 3a, 3b Left.
- the sealing element 23 in the auxiliary piston 22 is located on the web between the groove 37a and the groove 37b. The hydraulic fluid displaced by the movement of the auxiliary piston 22 can now only pass through the overflow channel 33 from the hydraulic space 32b into the hydraulic space 32a.
- the piston 2 moves during the slow-running phase of the auxiliary piston 22 essentially under the action of the relatively weak closing spring 3c. This means that the piston 2 runs ahead of the auxiliary piston accelerated or faster.
- the speed of movement of the auxiliary piston is damped in slow speed phase II by the regulating valve 33a located in the overflow channel 33; this speed can be adjusted with the regulating valve.
- This is e.g. B. set so that the entire slow speed phase II of the auxiliary piston 22 is about 25 sec.
- the shut-off valve 33b is open when the door is open. As soon as the piston 2 reaches its left end position when the door is closed, the shut-off valve 33b in the overflow channel 33 is closed by a corresponding mechanism. The auxiliary piston 22 is thereby held in its current position, and the residual energy stored in the reserve springs 3a, 3b is retained. This means that the slow speed phase is usually stopped prematurely.
- the overflow channel 33 remains open.
- the auxiliary piston 22 moves slowly, for example up to a door angle position of, for example, 45 °, from which the sealing element 23 is located above the groove 37b.
- a hydraulic short circuit now occurs again between the hydraulic spaces 32b and 32a, and the residual energy stored in the reserve springs 3a and 3b is used in addition to the energy of the spring 3c to close the door.
- the weaker closing spring 3c is simultaneously compressed and the starting position of the door closer shown in FIG. 1 is again obtained.
- FIG. 5 Another possibility for controlling the movement of the auxiliary piston 22 is shown in FIG. 5.
- the sealing element 23 is located at a corresponding point in the cylinder bore and the grooves 37a, 37b are made in the piston skirt 22a of the auxiliary piston 22.
- FIGS. 8 to 10 Another possibility for opening and closing the flow opening of the channel 33 is shown in FIGS. 8 to 10.
- a seal 35 (preferably made of elastomer material) is inserted into the piston 2.
- the piston 2 is guided so that it cannot rotate about its longitudinal axis.
- the seal 35 is attached so that it closes the mouth 33c of the overflow channel 33 in the hydraulic space 32a in the left end position of the piston 2 when the door is closed.
- the seal 35 can also be supported in its effect by a stored spring element.
- the overflow channel 33 can be designed such that the deep hole 36 is closed at a suitable point by a plug 34. 8 shows the overflow channel 33 (as part of the deep hole), the mouth 33c and the adjustable regulating valve 33a to the right of the sealing plug. To the left of the sealing plug 34 is the known hydraulic circuit for the piston 2 for controlling the end stroke and the closing time.
- the overflow channel mouth 33c is closed by the sealing element 2d embedded in the piston 2. The overflow channel opening 33c is then in the closed position of the piston 2 on the sealing element 2d.
- the swing energy of the door can then recharge the already preloaded reserve energy store, which at the same time dampens the opening movement of the door and signals the end of the door opening angle to the user through increased opening resistance.
- the closing spring 3c is weaker than the sum of the reserve closing springs 3a, 3b connected in parallel.
- the closing spring 3c is designed so that during normal operation, if there is no special closing resistor, e.g. in the form of wind pressure or obstacles in the closing path, is able to close the door completely, i.e. to move the piston 2 to its left end position before the auxiliary piston 22 has completely run through its slow-running phase II and thus before the reserve energy store with the reserve spring 3a, 3b is substantially discharged.
- control can be provided via a sensor device which cancels the hydraulic determination or deceleration of the auxiliary piston 22 by actuating the valve 33a or 33b if the door does not close properly.
- a sensor device can, for. B. be designed such that it monitors the pressure in the hydraulic chamber 31 by detecting the pressure drop that occurs when the closing process is interrupted before the door comes into the fully closed position. This drop in pressure always occurs when the door is stopped during the closing process.
- a hydraulic control piston can be operated, which can be arranged in a hydraulic connection system that connects the hydraulic chambers 31, 32a or 32b formed in front of and behind the piston 2. The hydraulic control piston can then switch the valve 33a or 33b under the effect of the pressure drop.
- Sensor devices can also be used which detect the door movement or correspondingly moving components of the door closer during the closing process or a delay or the stopping of the closing movement before the end position is reached.
- a mechanical blocking device can also be provided in other exemplary embodiments which mechanically blocks the auxiliary piston 22, preferably in a fixed blocking position in which the reserve closer springs 3a, 3b be kept on standby in the maximum tensioned position.
- This blocking device can be controlled in a time-dependent manner or by means of a sensor device in a manner corresponding to the previous exemplary embodiments, so that the reserve closer springs 3a, 3b come into effect when necessary and completely close the door.
- a spring plate-like support member that is linearly guided in the spring receiving space can be provided, in particular, if the blocking takes place via a mechanical blocking device.
- This spring plate-like support member does not have to be hydraulically tight in the cylinder. This means that the same pressure is formed in the cylinder spaces 32a and 32b, namely without pressure when closing, as in the spring receiving space of a conventional hydraulic door closer.
- the mechanical blocking device can be designed as a detent ball device which interacts with the spring support member.
- the locking balls can preferably be controlled via a hydraulic control piston between a blocking and a release position, wherein the hydraulic control piston can be controlled in the manner described above depending on a sensor device.
- the closing spring device and the reserve spring device can each be composed of a different number of springs.
- the closing spring 3c can be supported on the piston 2 on the one hand and on the support member on the other hand, or alternatively on the end of the cylinder space 32b, in particular in the case of designs with a spring plate-shaped support member which also supports the reserve springs 3a, 3b supported on the spring plate-like support member.
Landscapes
- Closing And Opening Devices For Wings, And Checks For Wings (AREA)
- Power-Operated Mechanisms For Wings (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft einen Türschließer mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
- Herkömmliche hydraulische oder pneumatische Türschließer sind als Bodentürschließer z. B. aus DE-OS 25 35 244 oder als obenliegende Türschließer z. B. aus DE-OS 28 19 334 bekannt. Diese Türschließer weisen als Energiespeicher eine Schließerfeder auf. Nachteilig dabei ist, daß beim Öffnen der Tür jeweils die Schließerfeder entgegenwirkt und daher zum Öffnen erhöhter Kraftaufwand erforderlich ist. Hinzu kommt, daß in der Praxis häufig relativ starke Schließerfedern erforderlich sind, um im Notfall ein sicheres Schließen der Tür sicherzustellen, z. B. bei Feuerschutztüren.
- Ein Türschließer der eingangs genannten Art, der einen aus zwei Schließerfedern zusammengesetzten Energiespeicher aufweist, von denen der erste Teilenergiespeicher zum Schließen beim Normalbetrieb dient und der zweite Energiespeicher lediglich bei Bedarf zugeschaltet wird, ist aus der DE-OS 42 37 179 bekannt. Es handelt sich um einen hydraulischen Türschließer mit zwei Schließerfedern, wobei im Normalbetrieb lediglich die schwächere Schließerfeder wirksam ist und die stärkere Schließerfeder über eine elektrische Arretiervorrichtung festgestellt wird und lediglich im Notfall über einen Feuermelder, Brandmelder oder dergleichen zugeschaltet wird. Dies bedeutet aber, daß bei Auftreten von Winddruck oder einem anderen Hindernis im Schließweg der Tür ein vollständiges Schließen nicht gewährleistet ist, solange die elektrische Arretiervorrichtung eingeschaltet ist.
- Aus DE-OS 28 44 302 und DE-OS 27 51 859 sind sogenannte Free-Swing-Schließer bekannt. Es handelt sich um hydraulische Türschließer, deren Schließerfeder bei Normalbetrieb in einem vorgespannten Zustand gehalten wird und lediglich im Notfall, z. B. im Brandfall, zugeschaltet wird. Diese Türschließer wirken nur in dem betreffenden Notfall. Im Normalbetrieb ist keine Schließwirkung vorhanden.
- Aus der DE-OS 32 34 319 und DE-OS 34 23 242 sind sogenannte Servo-Türschließer bekannt. Es handelt sich um hydraulische Türschließer mit Schließerfeder und einem elektrischen Motor, um die Schließerfeder beim Öffnen vorzuspannen. Durch das elektromotorische Vorspannen der Schließerfeder wird der Öffnungswiderstand der Tür beim manuellen Begehen eliminiert oder zumindest reduziert. Der Schließvorgang erfolgt sodann selbsttätig wie bei einem herkömmlichen hydraulischen Türschließer unter Wirkung der Schließerfeder. Bei jedem Öffnungsvorgang muß die Schließerfeder erneut elektromotorisch vorgespannt werden, um den Servo-Effekt zu erhalten.
- Nachteilig bei diesen Servo-Türschließern ist, daß also Fremdenergie erforderlich ist und der Aufbau relativ komplex ist.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Türschließer der eingangs genannten Art zu entwickeln, der im Normalbetrieb geringen Öffnungswiderstand aufweist und ein vollständiges Schließen der Tür sicherstellt.
- Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 gelöst. Mit dem Zeitglied wird eine einfache und kostengünstige Steuerung der Entladung des zweiten Teilenergiespeichers möglich, wobei mit der zeitgesteuerten Entladung des zweiten Teilenergiespeichers zusätzliche Energie zum Schließen der Tür zuverlässig zur Verfügung gestellt wird. Die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers kann auch über eine den Schließvorgang überwachende Sensoreinrichtung gesteuert werden, z. B. über eine Einrichtung, die feststellt, ob die Schließbewegung vor Erreichen der Schließlage unterbrochen wird. Die Sensoreinrichtung erfaßt z. B. aktuelle Betriebsdaten des Türschließers oder der Tür, z. B. den Betriebsdruck in einem Kolben-Zylinder-System im Türschließer oder die Bewegungsgeschwindigkeit oder die Bewegungsrichtung der Tür oder Türstellungen oder Änderungen von diesen Daten.
- Der zweite Teilenergiespeicher stellt einen Reserveenergiespeicher dar. Durch das Zeitglied bzw. die Sensorseinrichtung wird sichergestellt, daß der zweite Teilenergiespeicher selbsttätig zum sicheren Schließen der Tür wirksam wird, wenn die Tür unter Wirkung des ersten Teilenergiespeichers die Schließlage nicht erreicht.
- Der zweite Teilenergiespeicher kann mit einer steuerbaren Blockiereinrichtung zusammenwirken. Die Blockiereinrichtung bzw. ein Stellglied der Blockierenrichtung wird über das Zeitglied bzw. die Sensoreinrichtung gesteuert. Die Blockiereinrichtung kann den zweiten Teilenergiespeicher je nach ihrer Ausführung hydraulisch, pneumatisch, mechanisch oder elektrisch blockieren.
- Vorzugsweise ist das Zeitglied einstellbar oder programmierbar. Das Zeitglied kann in einer Überströmeinrichtung in einer Kolben-Zylinder-Einrichtung angeordnet sein und durch den Strömungswiderstand der Überströmeinrichtung bestimmt werden. Die Überströmeinrichtung kann die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers steuern.
- Die Teilenergiespeicher können durch in einem Zylinder dicht geführte hintereinandergeschaltete Kolben gebildet werden. Als Zeitglied der Überströmeinrichtung kann ein Strömungsventil dienen, vorzugsweise ein einstellbares Strömungsventil.
- Zusätzlich oder alternativ kann auch ein Überströmkanal oder eine Überströmnut im Zylinder oder im Kolben angeordnet sein. Abhängig von der Stellung des Kolbens des zweiten Teilenergiespeichers kann in der Überströmeinrichtung unterschiedlicher Widerstand geschaltet werden bzw. unterschiedliche Überströmeinrichtungen mit unterschiedlichem Widerstand nacheinander wirksam werden, z. B. indem nacheinander eine Überströmnut als Kurzschlußnut, dann ein Überströmkanal mit einstellbarem Strömungsventil und schließlich anschließend wieder eine Überströmnut als Kurzschlußnut wirksam wird; anstelle der Kurzschlußnuten können auch Kurzschlußkanäle vorgesehen sein.
- Damit ist es möglich, daß die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers aufeinander folgende Entladungsphasen unterschiedlicher Entladungsgeschwindigkeit aufweist. Es kann damit realisiert werden, daß die zeitverzögerte Entladung des zweiten Teilenergiespeichers z. B. zunächst sehr langsam erfolgt und wenn nach einer bestimmten Zeit die Tür noch nicht ihre Endlage erreicht hat, sodann die Entladungsgeschwindigkeit erhöht wird und also der zweite Teilenergiespeicher in dieser Phase verstärkt zum Schließen beiträgt. Es können vorzugsweise drei Phasen nacheinander ablaufen und zwar eine erste Phase, in der der zweite Teilenergiespeicher dazu dient, eine starke Kraft zum anfänglichen schnellen Beschleunigen der Tür beim Schließen zur Verfügung zu stellen, eine zweite Phase, in der er nur relativ langsam entladen wird und wenig zum Schließen beiträgt und für den Fall, daß die Tür nach einer bestimmten Zeit die Schließlage noch nicht erreicht hat, eine dritte Phase abläuft, in der der zweite Teilenergiespeicher schnell entladen wird und die Tür schließt.
- Sinnvollerweise speichert der erste Teilenergiespeicher weniger Energie als der zweite Energiespeicher, der durch die zeitabhängige Steuerung zeitverzögert soweit erforderlich zum Schließen wirksam wird.
- Konstruktiv besonders einfache Lösungen ergeben sich, wenn als Teilenergiespeicher Schließerfedern vorgesehen sind, vorzugsweise Schraubendruckfedern. Die Federn können im Zylinder einer pneumatischen oder hydraulischen Kolben-Zylinder-Einrichtung angeordnet sein und mit den im Zylinder dichtgeführten Kolben zusammenwirken.
- Im nachfolgenden werden Ausführungsbeispiele in Verbindung mit Figuren erläutert. Die Figuren zeigen:
- Figur 1
- eine schematische Schnittdarstellung eines Türschließers in Betriebsstellung vor dem ersten Schließen bei geschlossener Tür;
- Figur 2
- eine Figur 1 entsprechende Darstellung, wobei der Türschließer in Normalbetriebsstellung bei geschlossener Tür und bei festgestellter Reserveschließfeder gezeigt ist;
- Figur 3
- eine Figur 2 entsprechende Darstellung, wobei der Türschließer ebenfalls in Normalbetriebsstellung, jedoch bei nicht vollständig geschlossener Tür und nachlaufender Reserveschließfeder gezeigt ist.
- Figur 4
- eine Figur 3 entsprechende Darstellung, wobei eine andere Variante der Anordnung von Hilfskolben und Reserveschließfedern gezeigt wird;
- Figur 5
- eine Figur 1 entsprechende Darstellung mit einer Variante des Hilfskolbens und eines in der Zylinderwand angebrachten Dichtelements;
- Figur 6
- eine Figur 5 entsprechende Darstellung mit einem im Kolbenhemd angebrachten Dichtelement;
- Figur 7
- Darstellung der Überströmnuten in der Zylinderwand;
- Figur 8
- Darstellung der Kolben- und Dämpfungssteuerung;
- Figur 9
- Schnitt durch Kolben und Gehäuse entlang Linie IX-IX in Figur 8;
- Figur 10
- Detailansicht von Figur 9.
- Der in Figur 1 bis 3 dargestellte Türschließmechanismus weist ein Gehäuse 1 auf, in dem sich in einer zylindrischen Bohrung ein hydraulisch bedämpfter Kolben 2, ein Hilfskolben 22 und eine Federanordnung 3 befinden.
- Der Kolben 2 ist mit einer im Gehäuse 1 drehbar gelagerten Schließerwelle 4 getriebemäßig, im dargestellten Fall über einen Zahntrieb, verbunden. Der Zahntrieb besteht aus einem mit der Schließerwelle 4 drehfest verbundenen Ritzel 4a und einer kolbenfesten Zahnstange 2a. Bei der Öffnungsbewegung der Tür dreht das Ritzel 4a bzw. die Schließerwelle 4 in der Darstellung in den Figuren in Gegenuhrzeigersinn. Dabei wird der Kolben 2 nach rechts bewegt. Bei der Schließbewegung der Tür erfolgt die Bewegung in umgekehrter Richtung, d.h. das Ritzel 4a bzw. die Schließerwelle 4 dreht in Uhrzeigersinn und der Kolben 2 wird nach links bewegt.
- Die Schließfedereinrichtung 3 besteht aus einer Schließfeder 3c und zwei Reserveschließfedern 3a, 3b. Die Federn 3a, 3b, 3c sind Druckfedern. Es handelt sich um konzentrisch angeordnete Schraubendruckfedern. Die Schließfeder 3c stützt sich mit ihrem linken Ende unmittelbar an der rechten Stirnseite des Kolbens 2 und mit ihrem rechten Ende an einem Hilfskolben 22 ab. Der Hilfskolben 22 ist in dem Zylinderraum rechts vom Kolben 1 aufgenommen und ebenfalls als Hydraulikkolben in dem Zylinderraum verschiebbar geführt. Die Reserveschließfedern 3a, 3b stützen sich jeweils mit ihrem linken Ende an dem Hilfskolben 22 und mit ihrem rechten Ende am rechten Stirnende des Gehäuses 1 an einem dort eingeschraubten Gehäusedeckel 1r ab.
- Der Hilfskolben 22 ist topfförmig ausgebildet und besteht aus einem rohrförmiges Kolbenhemd 22a sowie einem Kolbenboden 22b. Kolbenhemd und Kolbenboden können aus einem Teil bestehen (Figur 1 bis 4) oder wie z.B. in Figur 5 und 6 dargestellt, aus 2 Teilen, die druckdicht, z. B. durch eine Klebe- oder Schweißverbindung, miteinander verbunden sind. Zur Bearbeitungsvereinfachung kann der Durchmesser des Kolbenhemds 22a am kolbenbodenseitigen Ende des Kolbens 22 geringer ausgeführt werden als in dem Bereich, in dem das Kolbenhemd die axiale Führung im Kolben übernimmt.
- Es bestehen mehrere Möglichkeiten, die Federelemente 3 zusammen mit dem Hilfskolben 22 anzuordnen: In der in Figur 1 bis 3 dargestellten Variante wird die innere Reserveschließfeder 3a im Kolbeninneren konzentrisch aufgenommen. Das linke Ende der Feder 3a stützt sich gegen den Kolbenboden 22b ab. Sie ragt aus dem Kolben nach rechts heraus und stützt sich mit ihrem rechten Ende am Gehäusedeckel 1r ab. Konzentrisch zur Feder 3a ist die zweite Reserveschließfeder 3b angeordnet. Sie stützt sich mit ihrem linken Ende gegen die Endfläche des Kolbenhemds 22a ab, mit ihrem rechten Ende stützt sie sich gegen den Gehäusedeckel 1r ab. Die Führung des Hilfskolbens 22 im Zylinder geschieht über das Kolbenhemd 22a, dessen linkes Ende der Kragen 22c bildet. Links des Kragens 22c verjüngt sich der Außendurchmesser des Kolbens 22 zum Kolbenaußenmantel 22d. Konzentrisch zum Kolbenaußenmantel 22d ist die Schließfeder 3c angeordnet. Die Feder 3c stützt sich mit ihrem rechten Ende gegen den Kragen 22c ab, mit ihrem linken Ende gegen die rechte Stirnfläche des Kolbens 2. Im Kolbenhemd 22a befindet sich das Dichtungselement 23, das den Hydraulikraum 32a gegenüber dem Hydraulikraum 32b abdichtet.
- Eine weitere Variante zur Anordnung der Federelemente 3 und des Hilfskolbens 22 ist in Figur 4 bis 6 dargestellt: Der Hilfskolben 22 ist gegenüber Figur 1 bis 3 um 180° gedreht, so daß der Kolbenboden 22b nach rechts zeigt. Die konzentrischen Reservefedern 3a und 3b stützen sich mit ihren linken Enden gegen den Kolbenboden ab, mit ihren rechten Enden gegen den Gehäusedeckel 1r. Die Schließfeder 3c ist im Inneren des Hilfskolbens 22 konzentrisch zu diesem angebracht. Ihr rechtes Ende stützt sich von innen gegen den Kolbenboden 22b, ihr linkes Ende gegen die rechte Stirnfläche des Kolbens 2. Diese Anordnung bietet gegenüber der Anordnung in Figur 1 bis 3 den Vorteil, daß das im Kolbenhemd 22a angeordnete Dichtelement 23 nur über eine Zylinderfläche bewegt wird, die nicht mit der Schließfeder 3c in Berührung kommen kann. Die Schließfeder 3c könnte in Figur 1 bis 3 die Zylinderwandfläche beschädigen und so die Funktionsfähigkeit des Dichtelements 23 beeinträchtigen.
- Der Zylinderinnenraum und das Innere der Kolben 2 und 22 sind mit Hydrauliköl gefüllt (Figur 1 bis 6). Der Kolben 2 weist ein Dichtelement 2d (vorzugsweise aus Elastomermaterial) auf und unterteilt den Zylinderraum in einen Hydraulikraum 31 links des Dichtelemts 2d und einen Hydraulikraum 32 rechts des Dichtelements. Der Hydraulikraum 32 wird durch das Dichtelement 23 (vorzugsweise aus Elastomermaterial) seinerseits unterteilt in einen Raum 32a, der die Schließfeder 3c aufnimmt, und einen Raum 32b, der die Reservefedern 3a und 3b aufnimmt. In den Hydraulikräumen herrschen in Abhängigkeit von den verwendeten Federn 3 unterschiedliche Drücke, wobei gilt: Druck p1 (in Raum 31) > Druck p2 (in Raum 32a) > Druck p3 (in Raum 32b). Der Hydraulikraum 31 ist mit dem Hydraulikraum 32 über Hydraulikkanäle 36 (Figur 8) verbunden, die Strömungsventile zur Regulierung der Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit enthalten, wie dies bei herkömmlichen Türschließern bekannt ist.
- Ferner ist in der linken Stirnfläche des Kolbens 2 ein federbelastetes Rückschlagventil 2b angeordnet, das bei der Öffnungsbewegung öffnet, wenn der Kolben 2 in der Darstellung in den Figuren nach rechts bewegt wird. Außerdem ist, wie ebenfalls an sich bekannt, im Kolben 2 ein Überdruckventil 2c angeordnet.
- Das Dichtelement 23 kann entweder, wie in Figur 1 bis 4 gezeigt, im Kolbenhemd 22a angebracht sein oder, wie in Figur 5 dargestellt, an einer geeigneten Stelle in der Zylinderbohrung.
- Zur hydraulischen Steuerung des Hilfskolbens 22 ist ein Überströmkanal 33 ausgebildet, der die Hydraulikräume 32a und 32b verbindet. Der Überströmkanal enthält eine Drossel, vorzugsweise ein einstellbares Regulierventil 33a, mit dem die Durchströmgeschwindigkeit der Hydraulikflüssigkeit durch den Kanal und damit die Bewegungsgeschwindigkeit des Hilfskolbens eingestellt werden kann. Ein Absperrventil 33b im Überströmkanal wird geschlossen, wenn die Tür beim Schließvorgang ihre Endstellung erreicht hat. Außerdem ist im Kolbenboden 22b des Hilfskolbens ein federbelastetes Rückschlagventil 24 vorgesehen, welches sich zum Überströmen der Hydraulikflüssigkeit aus Raum 32b in den Raum 32a öffnet, wenn der Hilfskolben 22 nach rechts bewegt wird.
- Der dargestellte Türschließer funktioniert folgendermaßen. Die Tür wird von Hand geöffnet. Dabei dreht die Schließerwelle mit dem Ritzel 4a in Gegenuhrzeigersinn und der Kolben 2 wird zwangsweise nach rechts gegen Wirkung der Schließfedereinrichtung 3 verschoben. Hierbei wird aus der Anfangsstellung in Figur 1 der am Kolben 1 anliegende Hilfskolben 22 nach rechts mitgenommen und die Reserveschließfedern 3a, 3b komprimiert. Die in vorgespannter Stellung eingebaute Schließfeder 3c verbleibt dabei in ihrer vorgespannten Lage.
- Bei der Verschiebung des Hilfskolbens 22 nach rechts öffnet das Rückschlagventil 24, so daß das durch die Kolbenbewegung verdrängte Hydrauliköl aus dem Raum 32b in den Raum 32a überströmen kann. Wenn die Tür vollständig geöffnet ist, z.B. 180°, erreichen der Kolben 2 und der Hilfskolben 22 jeweils die rechte Endstellung, in der die Reserveschließfedern 3a, 3b maximal komprimiert sind.
- Der Schließvorgang erfolgt sodann unter der Wirkung der Schließfedereinrichtung 3 selbsttätig. Zu Beginn des Schließvorgangs (z. B. bei einer Winkelstellung der Tür zwischen 180° und 80°) soll die Tür zügig und mit größerer Kraft beschleunigt werden. Diese Schnellaufphase I dauert z.B. 2 Sekunden. Während dieser Phase ist der Hydraulikraum 32b mit dem Hydraulikraum 32a durch die Nut 37a verbunden (Figur 7), die einen hydraulischen Kurzschluß bewirkt. Hierdurch kann die Hydraulikflüssigkeit vom Raum 32b in den Raum 32a strömen und die Reserveschließfedern 3a, 3b bewegen den Hilfskolben mit großer Kraft nach links. Die Bewegung des Hilfskolbens wird über die Schließfeder 3c auf den Hauptkolben übertragen; gleichzeitig drückt die Schließfeder den Hauptkolben ebenfalls nach links. Durch die Bewegung des Kolbens 2 wird die Schließerwelle 4 gedreht.
- Während der Langsamlaufphase des Hilfskolbens bzw. der Tür (z. B. bei einer Winkelstellung zwischen 80° und 45°) bewegt sich der Hilfskolben 22 in einer Langsamlaufphase II entsprechend der Einstellung des Drosselventils 33 durch die Kraft der Reserveschließfedern 3a, 3b sehr langsam nach links. Das Dichtelement 23 im Hilfskolben 22 befindet sich auf dem Steg zwischen der Nut 37a und der Nut 37b. Die durch die Bewegung des Hilfskolbens 22 verdrängte Hydraulikflüssigkeit kann jetzt nur durch den Überströmkanal 33 vom Hydraulikraum 32b in den Hydraulikraum 32a gelangen.
- Der Kolben 2 bewegt sich während der Langsamlaufphase des Hilfskolbens 22 im wesentlichen unter Wirkung der relativ schwachen Schließfeder 3c. Dies heißt, der Kolben 2 läuft vor dem Hilfskolben beschleunigt bzw. schneller vor.
- Die Bewegungsgeschwindigkeit des Hilfskolbens wird in der Langsamlaufphase II durch das sich im Überströmkanal 33 befindende Regulierventil 33a gedämpft; diese Geschwindigkeit kann mit dem Regulierventil eingestellt werden. Dieses wird z. B. so eingestellt, daß die gesamte Langsamlaufphase II des Hilfskolbens 22 ca. 25 sec beträgt.
- Das Absperrventil 33b ist bei geöffneter Tür geöffnet. Sobald der Kolben 2 seine linke Endstellung bei geschlossener Tür erreicht, wird über einen entsprechenden Mechanismus das Absperrventil 33b im Überstömkanal 33 geschlossen. Der Hilfskolben 22 wird hierdurch in seiner momentanen Stellung festgehalten, und die in den Reservefedern 3a, 3b gespeicherte Restenergie bleibt erhalten. Dies bedeutet, daß die Langsamlaufphase in der Regel vorzeitig gestoppt wird.
- Erreicht die Tür die Schließlage nicht, z.B. aufgrund erhöhten Winddrucks, so bleibt der Überströmkanal 33 geöffnet. Der Hilfskolben 22 bewegt sich langsam weiter, z.B. bis zu einer Türwinkelstellung von z.B. 45°, ab der sich das Dichtelement 23 über der Nut 37b befindet. Wie in der Schnellaufphase I entsteht jetzt wieder ein hydraulischer Kurzschluß zwischen den Hydraulikräumen 32b und 32a, und die in den Reservefedern 3a und 3b gespeicherte Restenergie wird zusätzlich zur Energie der Feder 3c zum Schließen der Tür genutzt. In dieser Schnellaufphase III wird gleichzeitig die schwächere Schließfeder 3c komprimiert und es ergibt sich wieder die in Figur 1 dargestellte Ausgangsstellung des Türschließers.
- Eine andere Möglichkeit zur Steuerung der Bewegung des Hilfskolbens 22 ist in Figur 5 dargestellt. Hier befindet sich das Dichtelement 23 an einer entsprechenden Stelle in der Zylinderbohrung und die Nuten 37a, 37b sind im Kolbenhemd 22a des Hilfskolbens 22 angebracht.
- Eine andere Möglichkeit zum Öffnen und Schließen der Durchflußöffnung des Kanals 33 ist in Figur 8 bis 10 dargestellt. Statt des Absperrventils 33b ist eine in den Kolben 2 eingelassene Dichtung 35 (vorzugsweise aus Elastomermaterial) vorhanden. Der Kolben 2 ist so geführt, daß er sich nicht um seine Längsachse verdrehen kann. Die Dichtung 35 ist so angebracht, daß sie in der linken Endstellung des Kolbens 2 bei geschlossener Tür die Mündung 33c des Überströmkanals 33 in den Hydraulikraum 32a verschließt. Hierdurch wird der Überströmkanal 33 zwischen den Hydraulikräumen 32b und 32a verschlossen und der Hilfskolben 22 wird so hydraulisch blockiert. Die Dichtung 35 kann zusätzlich noch in ihrer Wirkung durch ein hinterlegtes Federelement unterstützt werden.
- Der Überströmkanal 33 kann so ausgeführt werden, daß die Tieflochbohrung 36 an geeigneter Stelle durch einen Verschlußstopfen 34 verschlossen wird. In Figur 8 befinden sich rechts des Verschlußstopfens der Überstömkanal 33 (als Teil der Tieflochbohrung], die Mündung 33c und das einstellbare Regulierventil 33a. Links des Verschlußstopfens 34 befindet sich der an sich bekannte Hydraulikkreislauf für den Kolben 2 zur Steuerung des Endschlags und der Verschlußzeit.
- In einer anderen Ausführung geschieht der Verschluß der Überströmkanalmündung 33c durch das in den Kolben 2 eingebettete Dichtelement 2d. Die Überströmkanalmündung 33c befindet sich dann in der Schließstellung des Kolbens 2 an dem Dichtelement 2d.
- Für den Fall, daß die Reservefedern 3a, 3b beim Schließen nicht vollständig entladen wurden, sondern wie oben beschrieben beim Schließen hydraulisch blockiert wurden, wirken sie beim nachfolgenden Öffnen als Öffnungsdämpfer auf den letzten Grad Öffnungswinkel der Tür.
- Die Schwungenergie der Tür kann dann die bereits vorgespannten Reserveenergiespeicher nachladen, was gleichzeitig die Öffnungsbewegung der Tür bedämpft und dem Benutzer das Ende des Türöffnungswinkels durch erhöhten Öffnungswiderstand signalisiert.
- Da im Hydraulikraum 32 ein besonders hoher Betriebsdruck (ca. 50 bar) herrscht, ist eine spezielle Dichtung der Antriebswelle 4 im Gehäuse 1 erforderlich, um eine Leckage des Hydrauliköls aus dem Gehäuse zu verhindern.
- Bei einem erneuten Öffnen der Tür muß also nur der durch Spannung der Schließfeder 3c gebildete Öffnungswiderstand überwunden werden. Erst bei fortschreitendem Öffnungswinkel, wenn der Kolben in Anlage an den Hilfskolben 22 kommt, tritt der Öffnungswiderstand der Reserveschließfedern 3a, 3b auf. Dadurch wird eine Öffnungsdämpfung erhalten, die bei großen Türöffnungswinkeln erwünscht ist.
- Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Schließfeder 3c schwächer als die Summe der parallel geschalteten Reserveschließfedern 3a, 3b ausgebildet.
- Die Schließfeder 3c ist so ausgelegt, daß sie bei Normalbetrieb, wenn kein besonderer Schließwiderstand, z.B. in Form von Winddruck oder Hindernissen im Schließweg vorhanden ist, in der Lage ist, die Tür vollständig zu schließen, d.h. den Kolben 2 in seine linke Endlage zu verschieben, bevor der Hilfskolben 22 seine Langsamlaufphase II vollständig durchlaufen hat und also bevor der Reserveenergiespeicher mit der Reservefeder 3a, 3b wesentlich entladen ist.
- Es handelt sich also um einen hydraulisch gedämpften Türschließer, der eine relativ schwache Schließerfeder 3c und stärkere Reserveschließerfedern 3a, 3b aufweist, wenn die Tür in einer vorbestimmten Zeit nicht unter Wirkung der Schließerfeder 3c in Schließlage gelangt, werden die Reserveschließerfedern 3a, 3b zum Schließen zugeschaltet. Ihre Zuschaltung wird also über ein Zeitglied gesteuert, was eine einfache und zuverlässige Steuerung darstellt.
- Bei anderen Ausführungsbeispielen kann anstelle der zeitabhängigen Steuerung des Hilfskolbens 22 eine Steuerung über eine Sensoreinrichtung vorgesehen sein, die die hydraulische Feststellung oder Verzögerung des Hilfskolbens 22 durch Ansteuerung des Ventils 33a oder 33b aufhebt, wenn die Tür nicht ordnungsgemäß schließt. Eine solche Sensoreinrichtung kann z. B. derart ausgebildet sein, daß sie den Druck im Hydraulikraum 31 überwacht, indem sie den Druckabfall erfaßt, der auftritt, wenn der Schließvorgang unterbrochen wird, bevor die Tür in vollständige Schließlage gelangt. Dieser Druckabfall tritt immer auf, wenn die Tür beim Schließvorgang angehalten wird. Über den Druckabfall kann z. B. ein hydraulischer Steuerkolben betätigt werden, der in einem hydraulischen Verbindungssystem angeordnet sein kann, das die vor und hinter dem Kolben 2 gebildeten Hydraulikräume 31, 32a oder 32b verbindet. Der hydraulische Steuerkolben kann dann unter Wirkung des Druckabfalls das Ventil 33a bzw. 33b schalten.
- Es können auch Sensoreinrichtungen eingesetzt werden, die die Türbewegung oder entsprechend bewegte Bauteile des Türschließers beim Schließvorgang bzw. eine Verzögerung oder das Stoppen der Schließbewegung vor dem Erreichen der Endlage erfassen.
- Anstelle der bei dem Ausführungsbeispiel der Figuren vorgesehenen hydraulischen Feststellung des Hilfskolbens 22 über die Ventile 33a, 33b kann bei anderen Ausführungsbeispielen auch eine mechanische Blockiereinrichtung vorgesehen sein, die den Hilfskolben 22 mechanisch blockiert, vorzugsweise in einer festen Blockierposition, in der die Reseveschließerfedern 3a, 3b in maximal gespannter Stellung in Bereitschaft gehalten werden. Diese Blockiereinrichtung kann zeitabhängig oder über eine Sensoreinrichtung in entsprechender Weise wie bei den vorangehenden Ausführungsbeispielen gesteuert werden, so daß die Reserveschließerfedern 3a, 3b im Bedarfsfalle zur Wirkung kommen und die Türe vollständig schließen.
- Anstelle des Hilfskolbens 22 kann insbesondere dann, wenn die Blockierung über eine mechanische Blockiereinrichtung erfolgt, ein im Federaufnahmeraum linear geführtes federtellerartiges Stützglied vorgesehen sein. Dieses federtellerartige Stützglied muß also nicht hydraulisch dicht im Zylinder geführt sein. Dies bedeutet, daß in den Zylinderräumen 32a und 32b jeweils der gleiche Druck ausgebildet ist, nämlich beim Schließen drucklos, wie im Federaufnahmeraum eines herkömmlichen hydraulischen Türschließers.
- Die mechanische Blockiereinrichtung kann als Rastkugeleinrichtung ausgebildet sein, die mit dem Federstützglied zusammenwirkt. Die Rastkugeln können vorzugsweise über einen hydraulischen Steuerkolben zwischen einer Blockier- und einer Freigabestellung gesteuert werden, wobei der hydraulische Steuerkolben abhängig von einer Sensoreinrichtung in der zuvorbeschriebenen Weise gesteuert werden kann.
- Die Schließfedereinrichtung und die Reservefedereinrichtung kann jeweils aus einer unterschiedlichen Zahl von Federn zusammengesetzt sein.
- Abweichend von den in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen können anstelle von Schraubendruckfedern auch andere Federtypen verwendet werden, insbesondere auch Torsionsfedern.
- Anstelle der in den Figuren dargestellten Anordnung und Abstützung der Federn 3a, 3b, 3c kann insbesondere bei Ausführungen mit einem federtellerartig ausgebildeten Stützglied die Schließfeder 3c einerseits am Kolben 2 und andererseits an dem Stützglied oder aber alternativ an dem Ende des Zylinderraums 32b abgestützt sein, an dem auch die an dem federtellerartigen Stützglied abgestützten Reservefedern 3a, 3b abgestützt sind.
Claims (30)
- Türschließer für eine Tür mit einem Türflügel, vorzugsweise Drehflügel z.B. Anschlag-Schwenkflügel, Pendelflügel oder dergleichen
mit einem Energiespeicher zum Schließen des Türflügels, vorzugsweise mit Schließerfeder, wobei der Energiespeicher durch manuelles Öffnen der Tür bei der Öffnungsbewegung des Türflügels zumindest teilweise geladen und zum Schließen zumindest teilweise entladen wird,
wobei der Energiespeicher einen ersten Teilenergiespeicher und einen zweiten Teilenergiespeicher aufweist und das Schließen bei Normalbetrieb durch Entladung des ersten Teilenergiespeichers erfolgt und das Schließen durch Entladung des zweiten Teilenergiespeichers bedarfsweise unterstützt wird,
wobei vorzugsweise eine Einrichtung zur Regulierung oder Einstellung der Schließ- und/oder Öffnungsgeschwindigkeit vorgesehen ist, z.B. Dämpfungseinrichtung, vorzugsweise hydraulische oder pneumatische Dämpfungseinrichtung, insbesondere mit Kolben-Zylinder-Einheit,
dadurch gekennzeichnet, daß die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) abhängig von einem Zeitglied (33a, 37a, 37b) und/oder abhängig von einer den Schließvorgang überwachenden Sensoreinrichtung zur Unterstützung der Schließwirkung gesteuert wird. - Türschließer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) abhängig von dem Zeitglied (33a, 37a, 37b) derart gesteuert wird, daß sichergestellt wird, daß die Tür nach dem Öffnen innerhalb vorbestimmter Zeit vollständig schließt.
- Türschließer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Zeitglied (33a) bzw. die vorbestimmte Zeit einstellbar ist.
- Türschließer nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Entladung oder eine verstärkte Entladung des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) selbsttätig initiiert wird, wenn die Schließlage nicht in einer bestimmten Zeit erreicht wird bzw. wenn die den Schließvorgang überwachende Sensoreinrichtung auslöst.
- Türschließer nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) gestoppt wird, sobald die Schließlage oder eine der Schließlage nahe Türöffnungsstellung erreicht wird, wobei vorzugsweise vorgesehen ist, daß die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers gestoppt wird, wenn diese Lage vor Ablauf des Zeitglieds erreicht wird.
- Türschließer nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Entladung des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) beim Schließvorgang zumindest in einem bestimmten Türöffnungsbereich kontinuierlich, jedoch langsamer als die Entladung des ersten Teilenergiespeichers (2, 3c) erfolgt und/oder mit Entladungsphasen unterschiedlicher Entladungsgeschwindigkeit (I, II, III) erfolgt.
- Türschließer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die vor Erreichen der Schließendlage ablaufende letzte Entladungsphase (III) des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) relativ hohe Entladungsgeschwindkeit (III) aufweist im Vergleich zur Entladungsgeschwindigkeit des ersten Teilenergiespeichers (2, 3c) und/oder im Vergleich zur Entladungsgeschwindigkeit (I, II) des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) in einer oder mehreren vorangehenden Entladungsphasen (I, II).
- Türschließer nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die vor Erreichen der Schließendlage ablaufende letzte Entladungsphase (III) des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) einer Entladungsphase (II) mit relativ langsamer Entladungsgeschwindigkeit (II) folgt.
- Türschließer nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß vor der mit relativ langsamer Entladungsgeschwindigkeit (II) ablaufenden Entladungsphase (II) des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) eine Entladungsphase (I) mit relativ hoher Entladungsgeschwindigkeit vorgeschaltet ist.
- Türschließer nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Teilenergiespeicher (2, 3c) eine Kolben-Zylinder-Einrichtung (1, 2) mit einem in einem Zylinder dicht geführten ersten Kolben (2) aufweist und daß der zweite Teilenergiespeicher (22 3a, 3b) eine Kolben-Zylinder-Einrichtung (1, 22) mit einem in einem Zylinder dicht geführten zweiten Kolben (22) aufweist,
wobei vorzugsweise vorgesehen ist, daß der erste Kolben (2) und der zweite Kolben (22) in einem gemeinsamen Zylinder (1) geführt sind, vorzugsweise hintereinander geschaltet. - Türschließer nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Kolben (22) als hydraulischer oder pneumatischer Kolben (22) ausgebildet ist, der über ein in einer Überströmeinrichtung (33) angeordnetes Ventil (33a, 33b) steuerbar ist, insbesondere blockierbar und/oder feststellbar ist.
- Türschließer nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Kolben (22) über das Zeitglied (33a, 37a, 37b) pneumatisch oder hydraulisch steuerbar ist.
- Türschließer nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Zeitglied in einer Überströmeinrichtung ausgebildet ist, die einen vor dem zweiten Kolben (22) gebildeten Zylinderraum (32a) mit einem hinter dem zweiten Kolben (22) gebildeten Zylinderraum (32b) verbindet, wobei das Zeitglied vorzugsweise ein Strömungsventil (33a), insbesondere einstellbares Strömungsventil (33a), und/oder einen Überstromkanal (33) und/oder eine Überströmnut (37a, 37b) im Zylinder und/oder im zweiten Kolben (22) aufweist.
- Türschließer nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß abhängig von der Stellung des zweiten Kolbens (22) in der Überströmeinrichtung unterschiedlicher Strömungswiderstand geschaltet wird bzw. Einrichtungen mit unterschiedlichem Strömungswiderstand (33a, 37a, 37b) nacheinander wirksam werden.
- Türschließer nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Bewegungsgeschwindigkeit des zweiten Kolbens (22) durch eine Überströmnut (37a, 37b) gesteuert wird, die in der Kolbenaußenwand oder in der Innenwandung des Zylinders ausgebildet ist.
- Türschließer nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Bewegungsgeschwindigkeit des zweiten Kolbens (22) durch einen Überstromkanal (33) gesteuert wird, der im Zylinder oder im Kolben ausgebildet ist.
- Türschließer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Überströmkanal (33) ein Regulierventil (33a) und/oder eine Absperrvorrichtung, z. B. ein Absperrventil (33b) angeordnet ist.
- Türschließer nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Absperrventil (33b) bei Erreichen der Schließlage der Tür und/oder bei Erreichen einer bestimmten Stellung des ersten Kolbens (2), vorzugsweise Schließendstellung des ersten Kolbens (2), die Bewegung des zweiten Kolbens (22) selbsttätig angehalten wird, vorzugsweise unter Speicherung der Restenergie des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) für den nächsten Schließvorgang.
- Türschließer nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Mündung (33c) des Überströmkanals (33) durch den ersten Kolben (2) verschlossen wird, sobald die Schließlage der Tür erreicht wird.
- Türschließer nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Kolben (2) eine Dichtung (35) aufweist, die mit der Mündung (33c) des Überstromkanals im Zylinder zusammenwirkt, vorzugsweise eine in einer Ausnehmung, vorzugsweise in einem Sackloch im ersten Kolben angeordnetes Dichtelement (35), vorzugsweise federbelastetes Dichtelement.
- Türschließer nach einem der Ansprüche 10 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Kolben (2) und der zweite Kolben (22) in dem Zylinderraum Hydraulikräume (31, 32a, 32b) bilden, die derart miteinander hydraulisch verbunden sind, daß in den Räumen unterschiedlicher Hydraulikdruck (P1, P2, P3) ausgebildet ist,
wobei ein erster Raum (31) vor dem ersten Kolben (2) und ein zweiter Raum (32a) zwischen dem ersten Kolben (2) und dem zweiten Kolben (22) und ein dritter Raum (32b) hinter dem zweiten Kolben (22) ausgebildet sind und beim Schließen in dem ersten Raum (31) ein höherer Druck als im zweiten Raum (32a) und im zweiten Raum (32a) ein höherer Druck als im dritten Raum (32b) ausgebildet ist. - Türschließernach einem der Ansprüche 10 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem ersten Kolben (2) eine Abtriebswelle (4) zusammenwirkt, vorzugsweise über einen Zahntrieb, z. B. mit einer kolbenseitigen Zahnstange (2a) und einem abtriebswellenseitigen Ritzel (4a).
- Türschließer nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtriebswelle (4) im Zylindergehäuse drehbar gelagert ist unter Abdichtung mittels einer für hohe Drücke ausgelegten Dichtung, vorzugsweise für Hydraulikdrücke > 10 bar, vorzugsweise um ca. 50 bar.
- Türschließer nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Teilenergiespeicher (2, 3c) eine Kolbenzylindereinrichtung (2, 31, 32) mit einem in einem Zylinder (31, 32) dicht geführten ersten Kolben (2), vorzugsweise hydraulischem Kolben (2) aufweist, und der zweite Teilenergiespeicher (22, 3a, 3b) ein in einem Zylinder geführtes vorzugsweise federtellerartiges Stützglied aufweist, auf dem der zweite Teilenergiespeicher (22, 3a, 3b) abgestützt ist, wobei der zweite Teilenergiespeicher mit einer steuerbaren Blockiereinrichtung zusammenwirkt, die das Stützglied vorzugsweise mechanisch blockiert.
- Türschließer nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Blockiereinrichtung eine mit dem Stützglied des zweiten Teilenergiespeichers (2, 3a, 3b) zusammenwirkende Rasteinrichtung aufweist.
- Türschließer nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Rasteinrichtung als Kugelrasteinrichtung ausgebildet ist.
- Türschließer nach einem der Ansprüche 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß das Stützglied des zweiten Teilenergiespeichers (22, 3a, 3b) und/oder die Blockiereinrichtung mit der Sensoreinrichtung zusammenwirkt, wobei die Sensoreinrichtung den Druck und/oder eine Druckveränderung in einem Druckraum der Kolben-Zylindereinrichtung des ersten Teilenergiespeichers erfaßt.
- Türschließer nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Teilenergiespeicher (2, 2c) als energiespeicherndes Element eine erste Schließerfedereinrichtung (3c) und der zweite Teilenergiespeicher (22, 3a, 3b) als energiespeicherndes Element eine zweite Schließerfedereinrichtung (3a, 3b) aufweist.
- Türschließer nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Schließerfedereinrichtung (3c) geringere Federstärke aufweist als die zweite Schließerfedereinrichtung (3a, 3b).
- Türschließer nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Schließerfedereinrichtung (3d) einerseits auf dem Kolben (2) des ersten Teilenergiespeichers und andererseits auf dem Stützglied bzw. Kolben (22) des zweiten Teilenergiespeichers oder an einem zylinderfesten Anschlag abgestützt ist und die zweite Schließerfedereinrichtung (3a, 3b) einerseits auf dem Stützglied bzw. Kolben (22) des zweiten Teilenergiespeichers und andererseits auf einem zylinderfesten Anschlag abgestützt ist.
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19509621 | 1995-03-21 | ||
| DE19509621 | 1995-03-21 | ||
| DE19608023 | 1996-03-01 | ||
| DE19608023 | 1996-03-01 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP0733763A1 true EP0733763A1 (de) | 1996-09-25 |
| EP0733763B1 EP0733763B1 (de) | 2000-08-16 |
Family
ID=26013445
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP19960104540 Expired - Lifetime EP0733763B1 (de) | 1995-03-21 | 1996-03-21 | Türschliesser |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0733763B1 (de) |
| DE (2) | DE19611203A1 (de) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009140705A3 (de) * | 2008-05-19 | 2010-01-14 | Helmut Katherl | Vorrichtung zum selbstständigen verstellen eines flügels eines fensters oder einer tür mit einem federspeicher |
| CN101469587B (zh) * | 2007-12-28 | 2013-03-13 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 用于马达驱动的摆动门扇的安全系统 |
| EP2933414A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Türantrieb |
| EP2933415A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Türantrieb |
| EP2933413A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Türantrieb |
| EP2933412A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Drehtürantrieb |
| DE102018122289A1 (de) * | 2018-09-12 | 2020-03-12 | Hettich-Oni Gmbh & Co. Kg | Vorrichtung zum mechanischen Schließen eines bewegbaren Möbelteils und Verfahren zum Öffnen und Schließen eines bewegbaren Möbelteils |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102018202783A1 (de) * | 2018-02-23 | 2019-08-29 | Geze Gmbh | Antrieb für einen Flügel einer Tür oder eines Fensters |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3561036A (en) * | 1968-06-24 | 1971-02-09 | Rixson Inc | Hold-open apparatus for door |
| DE3203390A1 (de) * | 1982-02-02 | 1983-08-11 | Scovill Sicherheitseinrichtungen Gmbh, 5620 Velbert | Zahntrieb-tuerschliesser |
| DE3423242C1 (de) * | 1984-06-23 | 1985-11-07 | Dorma-Baubeschlag Gmbh & Co Kg, 5828 Ennepetal | Selbsttaetiger Tuerschliesser |
| DE4237179A1 (de) * | 1992-11-04 | 1994-05-05 | Geze Gmbh & Co | Türschließer |
-
1996
- 1996-03-21 DE DE1996111203 patent/DE19611203A1/de not_active Withdrawn
- 1996-03-21 EP EP19960104540 patent/EP0733763B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-03-21 DE DE59605738T patent/DE59605738D1/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3561036A (en) * | 1968-06-24 | 1971-02-09 | Rixson Inc | Hold-open apparatus for door |
| DE3203390A1 (de) * | 1982-02-02 | 1983-08-11 | Scovill Sicherheitseinrichtungen Gmbh, 5620 Velbert | Zahntrieb-tuerschliesser |
| DE3423242C1 (de) * | 1984-06-23 | 1985-11-07 | Dorma-Baubeschlag Gmbh & Co Kg, 5828 Ennepetal | Selbsttaetiger Tuerschliesser |
| DE4237179A1 (de) * | 1992-11-04 | 1994-05-05 | Geze Gmbh & Co | Türschließer |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101469587B (zh) * | 2007-12-28 | 2013-03-13 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 用于马达驱动的摆动门扇的安全系统 |
| WO2009140705A3 (de) * | 2008-05-19 | 2010-01-14 | Helmut Katherl | Vorrichtung zum selbstständigen verstellen eines flügels eines fensters oder einer tür mit einem federspeicher |
| EP2933414A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Türantrieb |
| EP2933415A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Türantrieb |
| EP2933413A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Türantrieb |
| EP2933412A1 (de) * | 2014-04-15 | 2015-10-21 | GEZE GmbH | Drehtürantrieb |
| CN105064847A (zh) * | 2014-04-15 | 2015-11-18 | 盖慈有限公司 | 门驱动装置 |
| CN105089413A (zh) * | 2014-04-15 | 2015-11-25 | 盖慈有限公司 | 转门驱动装置 |
| CN105064847B (zh) * | 2014-04-15 | 2017-10-27 | 盖慈有限公司 | 门驱动装置 |
| DE102018122289A1 (de) * | 2018-09-12 | 2020-03-12 | Hettich-Oni Gmbh & Co. Kg | Vorrichtung zum mechanischen Schließen eines bewegbaren Möbelteils und Verfahren zum Öffnen und Schließen eines bewegbaren Möbelteils |
| WO2020053094A1 (de) | 2018-09-12 | 2020-03-19 | Hettich-Oni Gmbh & Co. Kg | VORRICHTUNG ZUM MECHANISCHEN SCHLIEßEN EINES BEWEGBAREN MÖBELTEILS UND VERFAHREN ZUM ÖFFNEN UND SCHLIEßEN EINES BEWEGBAREN MÖBELTEILS |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE59605738D1 (de) | 2000-09-21 |
| DE19611203A1 (de) | 1996-09-26 |
| EP0733763B1 (de) | 2000-08-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0662185B1 (de) | Schwenktürantrieb | |
| EP0166285B1 (de) | Selbsttätiger Türschliesser | |
| DE2924311C2 (de) | ||
| DE19506220C2 (de) | Türschließer | |
| DE19538482C1 (de) | Hydraulischer Servotürschließer | |
| DE3234319C2 (de) | ||
| EP0137861B1 (de) | Selbsttätiger Türschliesser | |
| EP0733763B1 (de) | Türschliesser | |
| DE3502752C2 (de) | ||
| DE4212079A1 (de) | Fluidendruckfeder und Konstruktion mit einer solchen Fluidendruckfeder | |
| DE3320609C2 (de) | ||
| DE3925887A1 (de) | Doppelt wirkender pneumatischer antrieb fuer armaturen | |
| WO1999005379A1 (de) | Vorrichtung zum öffnen und/oder schliessen eines flügels einer tür, eines fensters oder dergleichen | |
| DD269588A5 (de) | Teleskoparm, insbesondere fuer ueber schwenkarme betaetigte, durch kippen sich mit der fahrzeugkarosserie verriegelnde aussenschwenktueren von fahrzeugen | |
| EP0613989A2 (de) | Schliessfolge-Steuerungsvorrichtung, insbesondere für Türen | |
| DE4239219A1 (de) | Selbsttätiger Türschließer | |
| EP1247931B1 (de) | Schliessfolgeregler | |
| DE3535506A1 (de) | Verfahren und anordnung zum steuern der kraft einer tuerschliessvorrichtung | |
| CH688203A5 (de) | Drehtürantrieb. | |
| EP0424708A2 (de) | Automatische Bodendichtung für eine Tür | |
| DE60320349T3 (de) | Türschliesser mit hydraulischer Dämpfung | |
| DE102012210813B3 (de) | Türschließer | |
| DE19524776A1 (de) | Türschließer mit hydraulischer Dämpfung | |
| EP0122325A2 (de) | Vorrichtung zum automatischen Rücköffnen von mit Drehsäulen betätigten Schwingtüren oder Schiebetüren bei Fahrzeugen | |
| DE112004000191B4 (de) | Antrieb für ein Turbinenventil |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): CH DE ES FR GB IT LI |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 19970315 |
|
| 17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19981218 |
|
| RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: GEZE GMBH |
|
| GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
| RAP3 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: GEZE GMBH |
|
| GRAG | Despatch of communication of intention to grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA |
|
| GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
| GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): CH DE ES FR GB IT LI |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY Effective date: 20000816 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: NV Representative=s name: E. BLUM & CO. PATENTANWAELTE Ref country code: CH Ref legal event code: EP |
|
| ITF | It: translation for a ep patent filed |
Owner name: BARZANO' E ZANARDO MILANO S.P.A. |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 59605738 Country of ref document: DE Date of ref document: 20000921 |
|
| GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 20000915 |
|
| ET | Fr: translation filed | ||
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 20010214 Year of fee payment: 6 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CH Payment date: 20010219 Year of fee payment: 6 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20010313 Year of fee payment: 6 Ref country code: DE Payment date: 20010313 Year of fee payment: 6 |
|
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| 26N | No opposition filed | ||
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: IF02 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020321 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LI Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020331 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20020331 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20021001 |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20020321 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20021129 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED. Effective date: 20050321 |